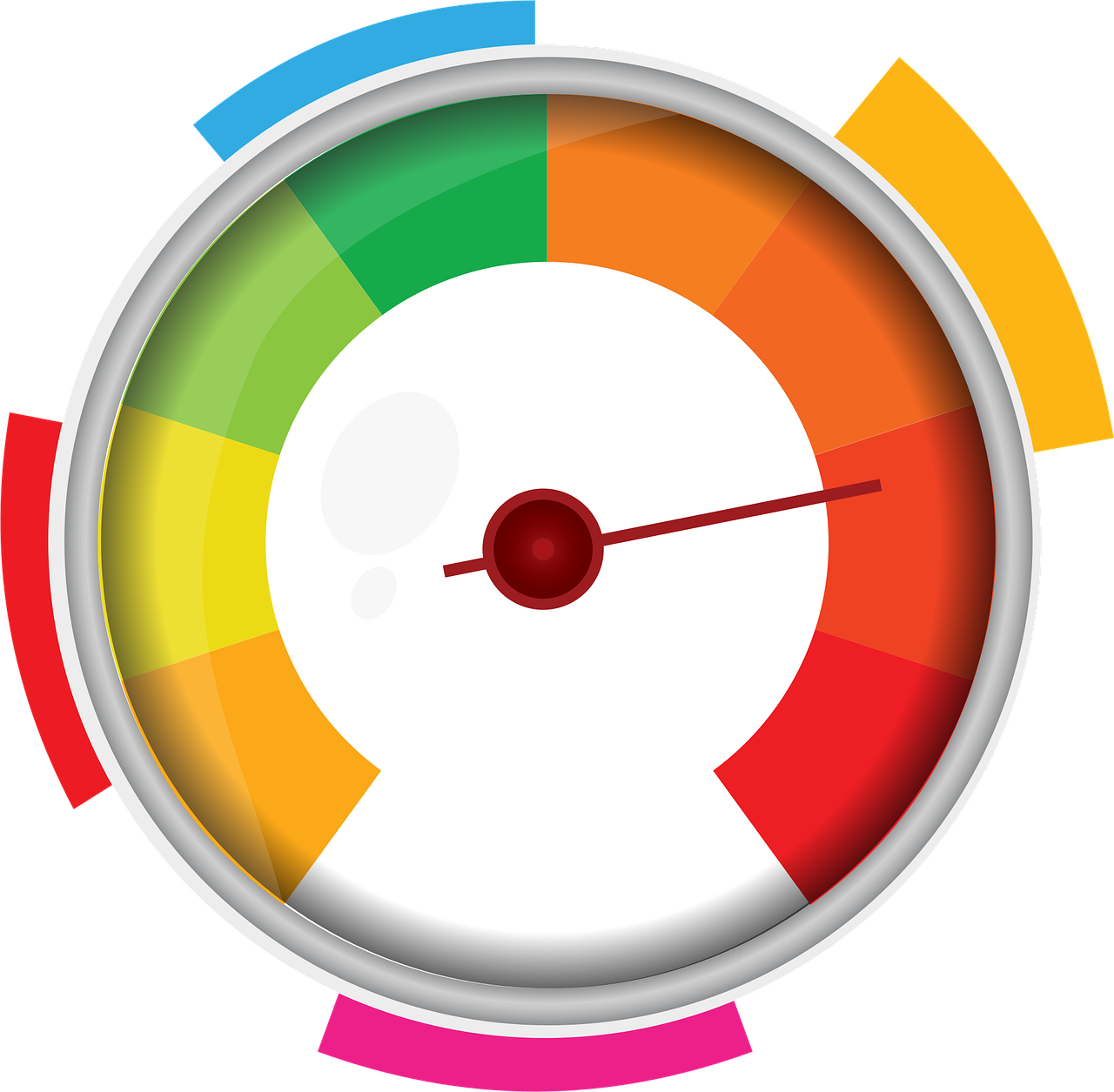Die Gesundheit eines Unternehmens spiegelt sich nicht nur in seinem Umsatz oder Gewinn wider, sondern wird durch eine Vielzahl von Kennzahlen sichtbar, die Aufschluss über Finanzstabilität, operative Effizienz und Mitarbeiterzufriedenheit geben. Mit dem stetig wachsenden Wettbewerbsdruck und den dynamischen Marktveränderungen im Jahr 2025 gewinnen präzise betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie Liquidität, Rentabilität, Produktivität und Mitarbeitergesundheit entscheidend an Bedeutung. Unternehmen, die ihre „Gesundheit“ zuverlässig messen und bewerten können, sind besser gerüstet, um Risiken zu minimieren und Wachstumschancen zu nutzen. Der Einsatz moderner Softwarelösungen von SAP, DATEV oder Lexware ermöglicht heute eine erweiterte Visualisierung dieser Kennzahlen, die durch externe Analysen von KPMG Deutschland, Ernst & Young Deutschland und PwC Deutschland ergänzt werden. Auch Plattformen wie Haufe und Statista liefern fundierte Daten und aktuelle Branchenbenchmarks, die helfen, den Status quo des eigenen Unternehmens fundiert einzuschätzen. Die folgenden Abschnitte widmen sich den wichtigsten Kennzahlen und deren Anwendung für unterschiedliche Unternehmensbereiche, ergänzt durch praxisnahe Beispiele und strategische Tipps.
Finanzkennzahlen als Fundament zur Bewertung der Unternehmensgesundheit
Die finanzielle Stabilität eines Unternehmens ist ein zentraler Indikator seiner Gesundheit. Ohne eine funktionierende Liquidität und Rentabilität sind weder Wachstum noch nachhaltige Investitionen möglich. Deshalb nehmen Finanzkennzahlen einen bedeutenden Platz bei der Analyse des Unternehmenszustands ein.
Liquidität: Der Pulsschlag der Unternehmensfinanzen
Die Liquidität zeigt an, ob ein Unternehmen in der Lage ist, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken. Dies ist entscheidend, um Zahlungsengpässe zu vermeiden, die den Geschäftsbetrieb gefährden können. Hierzu gehören Kennzahlen wie die Liquiditätsgrade (Liquidität 1., 2. und 3. Grades).
- Liquidität 1. Grades (Barliquidität): Verhältnis von flüssigen Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten.
- Liquidität 2. Grades: Einschluss kurzfristiger Forderungen neben den liquiden Mitteln.
- Liquidität 3. Grades: Berücksichtigung weiterer Vermögensbestandteile wie Vorräte.
Ein Beispiel: Ein Unternehmen mit Liquidität 1. Grades von 50 % bedeutet, dass nur die Hälfte der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch sofort verfügbare Mittel gedeckt ist. Im Marketingunternehmen „MediCraft“ veranschaulichte eine regelmäßige Liquiditätsanalyse mithilfe von DATEV und SAP die Notwendigkeit, Forderungsmanagement zu verbessern, um die Liquidität zu erhöhen.
Rentabilität: Effiziente Mittelverwendung messbar machen
Rentabilitätskennzahlen geben Auskunft über die Ertragsfähigkeit im Verhältnis zum eingesetzten Kapital. Diese Indikatoren zeigen auf, ob das Unternehmen mit seinen Ressourcen wirtschaftlich arbeitet.
- Eigenkapitalrentabilität: Verhältnis des Jahresüberschusses zum eingesetzten Eigenkapital.
- Gesamtkapitalrentabilität: Ertrag im Verhältnis zum gesamten Kapital inklusive Fremdkapital.
- Umsatzrentabilität: Verhältnis von Gewinn zum Umsatz, zeigt die Effizienz des operativen Geschäfts.
Haufe und Statista veröffentlichen regelmäßig Vergleichswerte für verschiedene Branchen. Ein Fertigungsbetrieb konnte mithilfe dieser Benchmarks erkennen, dass seine Umsatzrentabilität unter dem Branchendurchschnitt lag, weshalb eine Restrukturierung der Prozesskosten mithilfe von KPMG Deutschland empfohlen wurde.
| Kennzahl | Beschreibung | Empfehlung |
|---|---|---|
| Liquidität 1. Grades | Verhältnis flüssiger Mittel zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | Mindestens 20-30 % anstreben |
| Eigenkapitalrentabilität | Jahresüberschuss im Verhältnis zum Eigenkapital | Über 8 % gilt als gesund |
| Umsatzrentabilität | Gewinn im Verhältnis zum Umsatz | Abhängig von Branche, meist 3-10 % |
Diese finanzwirtschaftlichen Indikatoren geben Unternehmern eine solide Basis, um gezielte Maßnahmen zu ergreifen und die Wirtschaftlichkeit ihrer Firma zu verbessern.

Produktivitätskennzahlen: Wie effizient arbeitet Ihr Unternehmen?
Die Effizienz der betrieblichen Prozesse spielt eine entscheidende Rolle für den langfristigen Erfolg. Produktivitätskennzahlen ermöglichen es, den Output im Verhältnis zum Input zu beurteilen und Engpässe aufzudecken.
Arbeitsproduktivität und ihre Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit
Die Arbeitsproduktivität misst den Output je Arbeitseinheit, beispielsweise den Umsatz pro Mitarbeiter oder die Anzahl produzierter Einheiten pro Arbeitsstunde. Im Jahr 2025 setzen immer mehr Unternehmen auf digitale Tools, etwa SAP Analytics oder Lösungen von Lexware, um diese Kennzahlen in Echtzeit zu analysieren.
- Erhöhte Arbeitsproduktivität signalisiert bessere Ressourcennutzung und Kosteneinsparungen.
- Produktivitätsverlust kann auf ineffiziente Arbeitsabläufe oder fehlende Weiterbildung hinweisen.
- Langfristige Steigerung der Produktivität erhöht die Wettbewerbsfähigkeit und Marktposition.
Ein Fallbeispiel: Die Firma „TechSolutions“ führte mithilfe von PwC Deutschland eine Digitalisierungsinitiative ein, die ihre Produktivität innerhalb eines Jahres um 15 % steigerte.
Weitere wichtige Kennzahlen zur Prozessoptimierung
Zur ganzheitlichen Bewertung der Betriebseffizienz zählen auch:
- Durchlaufzeiten: Zeit vom Produktionsstart bis zur Fertigstellung eines Produkts.
- Ausschussquote: Anteil fehlerhafter Produkte am Gesamtoutput.
- Maschinenauslastung: Nutzung der technischen Kapazitäten im Verhältnis zur verfügbaren Zeit.
| Kennzahl | Bedeutung | Angestrebter Wert |
|---|---|---|
| Arbeitsproduktivität | Umsatz oder Output pro Mitarbeiter | Steigend, je nach Branche |
| Durchlaufzeit | Zeitdauer von Anfang bis Abschluss eines Prozesses | So kurz wie möglich |
| Ausschussquote | Qualitätskennzahl: Anteil fehlerhafter Produkte | Unter 5 % ideal |
Unternehmen, die diese Kennzahlen regelmäßig überwachen, können Schwachstellen identifizieren und gezielt Maßnahmen einsetzen, um Prozesse effizienter zu gestalten. Durch diese Optimierungen gelingt es, Kosten zu senken und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Gesundheits- und Sozialkennzahlen: Das Wohl der Mitarbeiter im Blick
Im Jahr 2025 rückt das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) zunehmend in den Fokus von Unternehmen. Die Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeiter sind maßgebliche Erfolgsfaktoren und wirken sich direkt auf Produktivität und Fehlzeiten aus. Kennzahlen zur Mitarbeitergesundheit ermöglichen eine fundierte Steuerung von Gesundheitsprogrammen.
Wichtige BGM-Kennzahlen und wie sie erhoben werden
Typische Kennzahlen, die Einblick in die Gesundheit der Belegschaft geben, sind:
- Fehlzeitenquote: Anteil der krankheitsbedingten Ausfälle an der Gesamtarbeitszeit.
- Präsentismus: Anteil der Mitarbeiter, die trotz Krankheit zur Arbeit erscheinen, oft mit verminderter Leistungsfähigkeit.
- Mitarbeiterzufriedenheit und Engagement: Erhoben durch regelmäßige Umfragen und Feedbackinstrumente.
Beispielsweise hat ein mittelständisches Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor mit Unterstützung von Haufe und BDSU ein Dashboard entwickelt, das diese Kennzahlen in Echtzeit aus DATEV-Daten visualisiert. Dadurch kann die Personalabteilung frühzeitig Maßnahmen planen und deren Wirkungen evaluieren.
Die Bedeutung von präventiven Maßnahmen und Weiterentwicklung
Unternehmen, die Gesundheitskennzahlen systematisch erfassen, erkennen Trends und können gezielt präventive Initiativen wie Stressmanagement oder ergonomische Arbeitsplatzgestaltung fördern. Ernst & Young Deutschland betont, dass Investitionen in die Mitarbeitergesundheit die Fluktuation reduzieren und die Arbeitgeberattraktivität erhöhen.
| Kennzahl | Beschreibung | Branchenübliche Werte |
|---|---|---|
| Fehlzeitenquote | Krankheitsbedingte Arbeitsausfälle | 3-5 % durchschnittlich |
| Präsentismus | Arbeiten trotz Krankheit | 10-15 % typisch |
| Mitarbeiterzufriedenheit | Ergebnis aus Umfragen | Mindestens 70 % positiv |
Gesundheitskennzahlen sind im betrieblichen Umfeld sensibel und sollten mit größter Sorgfalt erhoben und verarbeitet werden. Transparenz und Datenschutz spielen hierbei eine zentrale Rolle, um das Vertrauen der Belegschaft zu erhalten.
Markt- und Wettbewerbskennzahlen: Der externe Blick auf die Unternehmensgesundheit
Neben internen Zahlen ist auch das Marktumfeld ein entscheidender Faktor für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. Wie positioniert sich die Firma gegenüber Wettbewerbern? Welche Trends beeinflussen das Geschäft? Hier helfen Kennzahlen zur Markt- und Wettbewerbsanalyse.
Marktanteil und Wachstumsraten als Schlüsselindikatoren
Der Marktanteil zeigt den Anteil des Unternehmens am Gesamtmarktvolumen und spiegelt die Wettbewerbsfähigkeit wider. Wachstumsmessungen, etwa Umsatz- und Kundenwachstum, geben Aufschluss über die Dynamik des Unternehmens im Vergleich zum Markt.
- Marktanteile können mithilfe von Datenbanken wie Statista oder Handelsblatt-Analysen ermittelt werden.
- Wachstumsraten zeigen, ob die Geschäftsstrategie nachhaltig ist.
- Ein sinkender Marktanteil kann Frühwarnzeichen für Strategiewechsel sein.
So nutzte ein führendes Unternehmen in der Konsumgüterbranche die Datenanalyse von PwC Deutschland, um seine Position im Markt besser zu verstehen und gezielte Maßnahmen einzuleiten, die den Marktanteil innerhalb von zwei Jahren um 5 % steigerten.
Benchmarking als Mittel zur Selbstreflexion
Das Vergleichen mit Wettbewerbern und dem Branchenstandard ist etabliert, um die eigene Wettbewerbsposition realistisch einzuschätzen. Werkzeuge von KPMG Deutschland oder Lexware bieten heute umfangreiche Benchmarking-Reports.
| Indikator | Funktion | Nutzen |
|---|---|---|
| Marktanteil | Prozentualer Anteil am Marktvolumen | Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit |
| Umsatzwachstum | Prozentuale Steigerung des Umsatzes gegenüber Vorperioden | Erkennung von Wachstumstrends |
| Benchmarking | Vergleich mit Branchenstandards | Identifikation von Stärken und Schwächen |
Unternehmen, die regelmäßig Markt- und Wettbewerbskennzahlen auswerten, können Strategien flexibel anpassen und Handlungsspielräume optimal nutzen. Diese externe Perspektive rundet das Bild der Unternehmensgesundheit ab.
Technologische Kennzahlen und Digitalisierung als Treiber der Unternehmensentwicklung
Die digitale Transformation beeinflusst seit mehreren Jahren Unternehmensstrukturen und Arbeitsprozesse. Kennzahlen, die den Digitalisierungsgrad und technologische Infrastruktur bewerten, werden immer relevanter, um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig sicherzustellen.
Wichtige Digitalisierungskennzahlen im Überblick
Die Digitalisierung in Unternehmen zeigt sich neben Investitionen auch in der Nutzung digitaler Tools und der Effizienz von IT-Prozessen. Zu den Kennzahlen gehören:
- Digitalisierungsgrad: Anteil digitalisierter Geschäftsprozesse.
- IT-Ausfallzeiten: Dauer der Nichtverfügbarkeit von IT-Systemen, relevant für Betriebsstabilität.
- Mitarbeiterkompetenzen: Anteil der Mitarbeiter mit digitalen Qualifikationen.
Lexware und SAP bieten umfassende Module zur Erfassung und Auswertung dieser Kennzahlen. Unternehmen berichteten in Studien von Haufe, dass ein höherer Digitalisierungsgrad oft zu einer deutlichen Verbesserung der Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit führt.
Fallbeispiele für erfolgreiche Digitalisierung
Die BDSU stellt praxisorientierte Guidances bereit, wie Unternehmen ihre digitale Transformation messen und strukturieren können. So gelang es dem Produktionsunternehmen „Innovatech“, durch gezielte IT-Investitionen und Schulungen den Digitalisierungsgrad in zwei Jahren von 30 % auf 75 % zu steigern, begleitet von erheblichen Effizienzsteigerungen.
| Kennzahl | Ziel | Auswirkung |
|---|---|---|
| Digitalisierungsgrad | Über 70 % der Prozesse digitalisiert | Höhere Effizienz und schnellere Entscheidungsprozesse |
| IT-Ausfallzeiten | Unter 1 % der Betriebszeit | Erhöhte Betriebssicherheit |
| Mitarbeiterkompetenzen | Mindestens 60 % digital geschulte Mitarbeiter | Bessere Anpassungsfähigkeit an Marktanforderungen |
Die klare Messbarkeit und Steuerung von Digitalisierung lässt Unternehmen flexibel auf technologische Trends reagieren und verbessert nicht nur ihre Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch die Attraktivität als Arbeitgeber.

Welche Kennzahlen zeigen die Gesundheit meines Unternehmens?
Bitte geben Sie die aktuellen Werte (Ist-Wert) ein, um Ihre Unternehmenskennzahlen mit den Zielwerten zu vergleichen.
Die umfassende Betrachtung der Unternehmensgesundheit verlangt eine Integration von Kennzahlen unterschiedlicher Bereiche – von Finanzen über Produktivität bis hin zur Mitarbeitergesundheit und Digitalisierung. Dem Unternehmer steht heute eine Vielzahl an Instrumenten zur Verfügung, um mittels soft- und hardwaregestützter Tools Daten in Echtzeit auszuwerten. Das sichert nicht nur die Unternehmensstabilität, sondern fördert auch nachhaltige Entwicklung. Der Blick auf externe Benchmarks durch Partner wie KPMG Deutschland oder Ernst & Young Deutschland gewährleistet eine objektive Einschätzung. So bleibt ein Unternehmen agil, wettbewerbsfähig und gesund.
Fragen zur Unternehmensgesundheit und den wichtigsten Kennzahlen
- Wie erkenne ich, ob mein Unternehmen finanziell gesund ist?
Kennzahlen wie Liquidität 1. Grades, Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrentabilität sind grundlegende Indikatoren. Werte nahe oder über Branchenbenchmark zeigen Stabilität. - Welche Kennzahlen sind für die Mitarbeitergesundheit relevant?
Fehlzeitenquote, Präsentismus und Mitarbeiterzufriedenheit geben Einblicke in die Betriebsgesundheit und helfen, Maßnahmen gezielt zu steuern. - Wie kann ich die Produktivität im Unternehmen verbessern?
Regelmäßige Analyse der Arbeitsproduktivität, Ausschussquote und Durchlaufzeiten bilden die Basis für Prozessoptimierungen und damit höhere Effizienz. - Wozu dient Benchmarking im Unternehmenskontext?
Es ermöglicht den Vergleich mit Wettbewerbern und hilft, die eigene Marktposition realistisch einzuschätzen und anzupassen. - Welche Rolle spielt die Digitalisierung für die Unternehmensgesundheit?
Ein hoher Digitalisierungsgrad und gut geschulte Mitarbeiter sind Schlüsselfaktoren für Effizienz, Agilität und Innovationsfähigkeit.